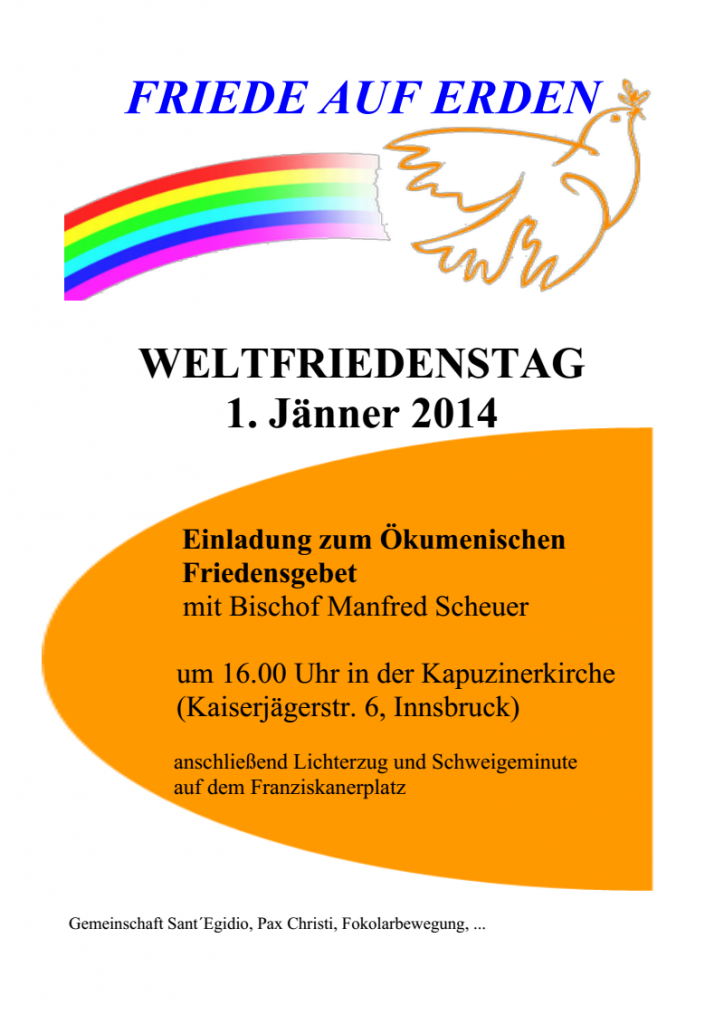Pax Christi Österreich begrüßt das Zustandekommen der internationalen Syrien-Konferenz in Genf und hofft, dass diese einen Beitrag zu einem gerechten Frieden für das leidgeprüfte Land und seine Bevölkerung leisten wird. Nach Auffassung der kirchlichen Friedens¬bewegung geht es darum, einerseits die territoriale Integrität und Unabhängigkeit des syrischen Staates sicherzustellen, andererseits den multi-ethnischen, multi-religiösen und multi-konfessionellen Charakter der syrischen Gesell¬¬schaft zu wahren sowie Menschenrechte, Menschenwürde und religiöse Freiheit für alle Menschen in Syrien zu verwirklichen. Um einen tatsächlichen Friedens¬prozess in Gang zu bringen, ist es notwendig, dass alle Parteien, die direkt oder indirekt an dem Konflikt beteiligt sind, auch an den Verhandlungen teilnehmen. In diesem Sinne spricht sich Pax Christi auch für eine Beteiligung des Iran an der Genfer Syrien-Konferenz aus und ist verwundert, dass der UNO-Generalsekretär zuerst kurzfristig eine Einladung ausgesprochen, diese dann aber postwendend wieder zurückgezogen hat.
In Übereinstimmung mit der jüngsten Konsultation kirchenleitender Personen aus Syrien, des Mittelost-Kirchenrates, des Weltkirchenrates und des Heiligen Stuhls bekräftigt Pax Christi seine tiefe Überzeugung, dass es keine militärische Lösung für Syrien geben kann. Vorrangige Ziele der Genfer Konferenz müssen daher ein vorläufiger Waffenstillstand, die Freilassung gefangener und entführter Personen sowie internationale Maßnahmen gegen die Einfuhr von Waffen und ausländischen Kämpfern in das Bürgerkriegsland sein. Weiters muss sichergestellt werden, dass alle Flüchtlinge in den Nachbarländern und in Syrien selbst entsprechende humanitäre Hilfe erhalten können. In diesem Zusammenhang ruft Pax Christi Österreich die Regierungen der Europäischen Union im allgemeinen und die österreichische Bundesregierung im besonderen auf, ihre humanitäre Hilfe für die syrischen Kriegsflüchtlinge zu erhöhen und mehr bedrohten Menschen vorüber¬gehend Asyl zu gewähren. Insbesondere appelliert Pax Christi an die österreichische Bundesregierung, die Quote für syrische Flüchtlinge – so wie Deutschland – zumindest zu verdoppeln und die Umsetzung ihrer Zusagen zu beschleunigen.